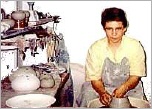Vom Töpferton zum Porzellan
Tonfarben
„Die Masse“ werden sämtliche feuchten Tone vor dem Brennen genannt – ganz einfach. Keramiker ordnen die Tonfarben nicht den rohen Tonen vor dem Brand zu. Diese können eine Farbe von organischen Teilchen annehmen, zum Beispiel von Pflanzenresten. Derart natürliche Verunreinigungen verbrennen bei spätestens 300 Grad Celsius. Die Tonfarbe wird danach bestimmt, wie der fertige Krug aus dem Brennofen kommt.
Ocker und Rot sind die Farben der eisenhaltigen Töpfertone. Dunkelbraune bis fast schwarze Tone zeigen einen unterschiedlich hohen Mangangehalt an. Fast überall auf der Welt gibt es diese Tone. Früher siedelten sich ganze Töpferwerkstätten neben solchen Tonvorkommen an. Ideal war die Verbindung mit einem Waldgebiet für genügend Brennmaterial. Im Brennofen schmelzen die Glasuren auf farbigen „Töpfertonen“ bei einer Temperatur ab 1040 Grad Celsius.
Die weissen oder grauen Steinzeugtone benötigen meistens über 1200 Grad, damit der Ton dicht wird und kein Wasser mehr durchsickern lässt. Diese Tone kommen nur in bestimmten Gebieten vor, zum Beispiel im Westerwald oder im Fichtelgebirge. Sie enthalten kein – oder nur wenig – Flussmittel wie Eisen oder Mangan, schmelzen also schwerer. Dafür sind sie aber dicht und lassen kein Wasser durch – vollkommen ohne Glasur.
Vollkommen weisses Porzellan darf überhaupt keine farbigen Einschlüsse enthalten. In unseren Gegenden kommt dieser Ton nicht in der Natur vor, sondern wird aus Natrium (Pottache), Kaolin und Quarz gemischt. Um die schneeweisse Farbe zu erzielen, wurden die Tonmehle früher mit Magneten abgesucht. Mit dem blossen Auge sieht keiner die kleinen Eisenteilchen, die nach dem Brand rote, braune oder schwarze Punkte im Ton hinterlassen – natürlich an den prominentesten Stellen. Heute werden winzige Metallspäne mit dem Ton vermischt, um eine interessantere Oberfläche zu erzielen.
Der Ausdruck Keramik kommt vom griechischen „Keramos“ und heisst übersetzt „Gebrannter Ton“. Alle vorher genannten Tone
– auch das Porzellan –
tragen also im gebrannten Zustand den Namen „Keramik“.
Sämtliche Tone, ebenso Glasuren und Glas, enthalten die gleichen Grundstoffe. Sie unterscheiden sich lediglich in der Zusammensetzung der einzelnen Komponenten. Die Verhältnisse zueinander entscheiden über die Schmelzbarkeit. Matte Glasuren tendieren eher zu Keramik, glänzende Glasuren zu Glas.
Geduld, Geduld, Geduld…
Das Aussehen der Glasuren erblickt die Keramikerin erst im geschmolzenen Zustand. Da ist Geduld angesagt, denn der Brennofen erreicht seine Temperatur ungefähr in 12 Stunden, je nach Grösse des Ofens. Zum Abkühlen benötigt er das Doppelte oder Dreifache an Zeit. Als Lehrling schlich ich immer um den Ofen und beschwor den Thermostat, doch ein bisschen schneller zu sinken, damit ich endlich einen Blick auf meine letzten Arbeiten werfen konnte.
Glasuren Grundlagen
Glasuren Beispiele
Keramikwerkstatt
Keramik Meine Keramik entsteht in reiner Handarbeit. Sie ist lebensmittelecht, wasserdicht, spülmaschinengeeignet und backofenfest. Ich drehe jedes Stück einzeln auf der Töpfer-Drehscheibe. Dabei gebrauche ich, außer meinen Händen, kaum Werkzeuge.
Tone und Massen „Die Masse“ werden sämtliche feuchten Tone vor dem Brennen genannt – ganz einfach. Keramiker ordnen die Tonfarben nicht den rohen Tonen vor dem Brennen zu. Diese können eine Farbe von organischen T…
Glasuren Beispiele Mineralien-Glasuren von Keramikmeisterin Astrid Dlugokinski. Genau wie Edelsteine weisen meine Glasuren keine einheitliche Oberfläche auf. Sie reagieren nämlich während des Brandes im Brenn…
Glasuren Grundlagen Bevor eine Glasur mit bestimmten Rohstoffen immer wieder neu angesetzt werden kann und jedesmal die gleichen Ergebnisse zeigt, müssen Proben erstellt werden. Aus diesen Probenreihen wird die beste …